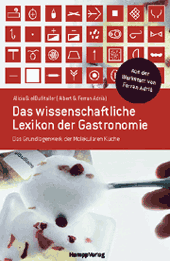Eine Episode, in der aus 24 Gramm Sauerteig 4 Kilo Brotteig werden und an deren Ende eine merkwürdige Beobachtung steht
Da sich der Sauerteig mittlerweile nach dem „Füttern“ immer verdoppelt hat, habe ich ihn das erste Mal verbacken. Hierbei habe ich mich an das klassische französische Dreistufenverfahren von Raymond Calvel, dem Vater des modernen französischen Brotes, gehalten, wie es auf dieser Seite beschrieben ist:
- Zunächst habe ich also 24g Starter-Sauerteig genommen, also fast nichts, und mit 48g Wasser und 120g Weißmehl vermischt. Der daraus entstandene Teig war etwas zäh, ließ sich aber nach einiger Zeit ordentlich kneten. Die Teigkugel habe ich dann 2 Stunden bei 24°C ruhen lassen.
- Dann habe ich die Teigkugel, die im inneren schon weich geworden war, zerpflückt und wieder mit 96g Wasser und 143g Mehl vermischt und gut durchgekneten. Darauf folgte eine neue Teigruhe bei 24°C, diesmal 8 Stunden lang.
- Nach der Ruhe war der Teig nicht nur deutlich weicher, sondern auch deutlich sichtbar aufgegangen. Wieder habe ich Wasser (190g) und Mehl (380g) hinzugefügt und das Ganze gut durchgeknetet. Das entstandene Kilo Sauerteig musste erneut 2 Stunden ruhen, wobei es wieder weicher und größer geworden ist.
- Jetzt die letze Vermehrung: Nach der Zugabe von 1.166g Wasser und 1.833g Mehl hatte ich 4 Kilo wundervoll geschmeidigen Sauerteig, der noch einmal 30 Minuten ruhen musste, bevor ich ihn dann in drei Klumpen à 1 Kilo sowie drei kleineren à 300g zerteilt habe. Noch einmal eine 1/4 Stunde Ruhezeit und dann durfen die Teiglaibe in ihre Formen. Einen Laib habe ich in ein geflochtenes Körbchen gelegt, einen Laib auf ein gemehltes Tajineunterteil und einen Laib in eine klassische Kastenform. Die drei kleinen Klumpen habe ich in eine selbstgebastelte Alu-Baguetteform gegeben.
- Nach Rezept folgten weitere 4 Stunden Teigruhe, da der Teig aber nach Ablauf der Zeit noch nicht genügend aufgegangen war, habe ich noch zwei weitere Stunden drangehängt und erst dann mit dem Backen begonnen.
Hier die Brote nach dem Teilen:
Hier die Brote in ihren Formen vor dem letzten Gehenlassen:
Die fertig gebackenen Brotlaibe sahen dann so aus – ziemlich rustikal:
Geschmacklich musste ich leider feststellen, dass alle Brote bis auf den hellen runden Laib eine etwas störende Essignote hatten, die wohl von den doch etwas zu zahlreichen Essigsäurebakterien in dem Sauerteig stammte. Da der Teig nicht weiter gewürzt war, sondern wirklich nur aus Mehl, Sauerteig und Wasser bestanden hat, war auch nichts da, was diese Note etwas unterdrücken konnte. Aber das ist nicht weiter schlimm, ich werde die Brote dann eben zu Gerichten mit Essignote essen.
Interessanterweise war ein Brot frei von diesem Beigeschmack: der helle runde Laib, den ich in dem Körbchen habe gehen lassen und den ich unter dem Tajinedeckel gebacken habe. Dieses Brot schmeckte wie ein klassisches neutrales Weißbrot mit knuspriger Kruste und saftiger, aber dennoch saugfähiger Krume wie man es aus Italienischen Restaurants kennt. Weiß jemand, warum dieses Brot nicht so sauer schmeckt wie die anderen? Liegt es daran, dass es in dem luftigen Körbchen nicht ganz so stark aufgegangen ist wie die anderen?
Hier ein Bild der Krume des leckeren Brotes:
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise, was ich das nächste Mal verbessern kann und wie ich meinen essigsauren Sauerteig wieder etwas milder bekomme.





 Dass Essen verbindet, dürfte keine große Überraschung sein. So hat die Ethnologie dafür einen eigenen Fachbegriff geprägt, die „Kommensalität“, und gerade in den abschätzig als „einfache“ Kulturen bezeichneten Gruppen unendlich komplexe Regelwerke gefunden, die eine Ordnung schaffen, wer mit wem wo was essen darf. Kulturgeschichtlich war Essen vermutlich niemals die einfache Angelegenheit, als die es immer wieder dargestellt wird – man setzt sich zusammen bei einem guten Mahl und genießt. Mitnichten. Man denke zum Beispiel an die dem indischen Kastensystem innewohnenden Vorbote der Kommensalität unterschiedlicher Kasten und die überlebensgroße Bedeutung der Reinheitsideen in diesem Symbolkomplex (vgl. dazu
Dass Essen verbindet, dürfte keine große Überraschung sein. So hat die Ethnologie dafür einen eigenen Fachbegriff geprägt, die „Kommensalität“, und gerade in den abschätzig als „einfache“ Kulturen bezeichneten Gruppen unendlich komplexe Regelwerke gefunden, die eine Ordnung schaffen, wer mit wem wo was essen darf. Kulturgeschichtlich war Essen vermutlich niemals die einfache Angelegenheit, als die es immer wieder dargestellt wird – man setzt sich zusammen bei einem guten Mahl und genießt. Mitnichten. Man denke zum Beispiel an die dem indischen Kastensystem innewohnenden Vorbote der Kommensalität unterschiedlicher Kasten und die überlebensgroße Bedeutung der Reinheitsideen in diesem Symbolkomplex (vgl. dazu 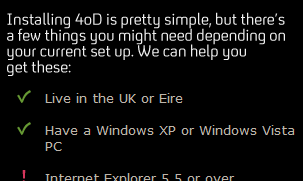

 Wahrscheinlich haben die meisten Leser dieses Blogs das Buch „The Man who ate everything“ von Jeffrey Steingarten bereits (mehrmals) gelesen. Wenn nicht: diese im Geiste einer unvergleichlichen Leichtigkeit geschriebene Sammlung von Artikeln, die Steingarten als Food Writer für Vogue und Slate verfasst hat, sind für jeden Gourmet ein Pflichtprogramm (
Wahrscheinlich haben die meisten Leser dieses Blogs das Buch „The Man who ate everything“ von Jeffrey Steingarten bereits (mehrmals) gelesen. Wenn nicht: diese im Geiste einer unvergleichlichen Leichtigkeit geschriebene Sammlung von Artikeln, die Steingarten als Food Writer für Vogue und Slate verfasst hat, sind für jeden Gourmet ein Pflichtprogramm ( Heute in der
Heute in der