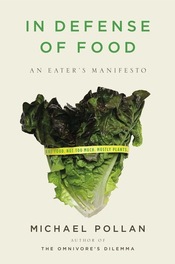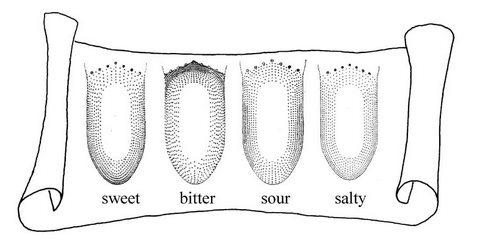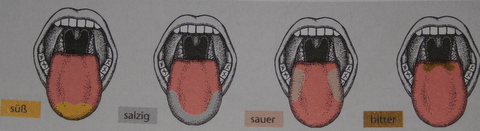In New York gibt es eine interessante Gruppierung, die sich „Culinary Historians of New York“ (CHNY) nennt. Die Mitglieder – Gourmets, Wissenschaftler, Historiker, Autoren und New York City-Fans – treffen sich im monatlichen Rhythmus um über diverse ernährungshistorische Themen vom Hamburger bis zum Absinth zu diskutieren. Das letzte Mal ging es um die Differenz zwischen einfacher und komplexer Ernährung. Dazu hatten sie sich die Nahrungshistorikerin Rachel Laudan, die im Übrigen auch ein eigenes, sehr lesenswertes Blog führt, eingeladen, die dort einen Vortrag hielt über
the differences between “refined cookery” and “plain fare.” This difference has played a role in civilized culture since the time of the ancient Greeks and continues at present in the form of “molecular gastronomy” versus “local, seasonal, organic” simple cuisine, or at the extreme, the “raw food” movement.
Auf den ersten Blick ist diese Differenz nachvollziehbar, zum Beispiel wenn man sich auf dem einen Teller einen Rohkostsalat vorstellt und auf dem anderen die Gemüsegelatinen von Ferran Adrià, die nur noch die Geschmacksessenzen ihrer Zutaten enthalten.
Schwierig wird es jedoch, wenn man sich fragt, was hier mit „molekularer Gastronomie“ gemeint ist. Wenn damit die kulinarische Aufklärung à la Thomas Vilgis, Harold McGee oder Hervé This gemeint ist, fällt dieser Unterschied in sich zusammen, da auch Rohzutaten bzw. sehr einfache Rezepte molekularkulinarisch analysiert und beschrieben werden kann. Zudem: ist ein Gelatinewürfel nicht „plain fare“?
Wenn dagegen die neue Avantgarde der Haute Cuisine gemeint ist, ist der Unterschied ebenfalls nicht so einfach. Das wird schnell deutlich, wenn man einen Blick in das Manifest Statement on the ’new cookery‘ wirft, das Ferran Adrià, Heston Blumenthal, Thomas Keller und Harold McGee gemeinsam veröffentlicht haben: „We wish to work with ingredients of the finest quality“. In Ferran Adriàs zweiten von 23 Geboten heißt es entsprechend:
die verwendung von produkten höchster qualität wird als selbstverständlich vorausgesetzt, ebenso wie das technische wissen, diese zu verarbeiten.
In den meisten der Avantgarderestaurants geht es dementsprechend um das Kochen mit lokalen und biologischen, z.T. auch saisonalen Produkten. Sergio Herman kocht in seinem Restaurant Oud Sluis saisonal, biologisch und lokal: das Paradebeispiel sind die Zeeland-Austern. In dem Artikel wird als Beispiel für die „einfache“ Küche David Changs Schweineimperium genannt. Aber: ist Adriàs Gemüsegelatine – Karotten entsaften, durch ein Sieb gießen, mit Gelatine und Agar versetzen – nicht sehr viel einfacher und „unprozessierter“ als jedes beliebige Gericht aus der Momofuku-Speisekarte?
Das spannende an der molekularen Gastronomie ist, dass sie eben diesen Unterschied zwischen einfach und kompliziert, bodenständig und wissenschaftlich und sogar dem Rohen und dem Gekochten in Teilen außer Kraft setzt.