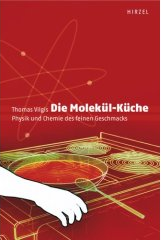Durch Heston Blumenthal habe die kulinarische Allzweckwaffe „Sternanis“ (früher bekannt unter dem Marathi-Namen „Badian“) schätzen gelernt, die sich zum Beispiel wundervoll dafür eignet, Umamikomponenten z.B. bei einem Fleischgericht, in den Vordergrund zu rücken. Auf den ersten Blick scheint der Name perfekt zu der Frucht zu passen, denn sie ist sternförmig und hat ein stark an Anis erinnerndes Aroma. Eine Tüte Sternanis zu öffnen ist für die Nase ein ebenso markantes Erlebnis wie das Öffnen einer Flasche Raki oder Ouzo (im Pastis wird Sternanis verwendet). Tatsächlich hat Sternanis (Illicium verum) aber nichts mit dem Namensvetter Anis (Pimpinella anisum) zu tun. Aber weil beide (wie auch Süßfenchel) die phenolische Substanz Anethol enthalten, ähneln sie sich geschmacklich und geruchlich. Allerdings ist Sternanis etwas intensiver, schärfer und lakritziger.
Auf diesem Foto sieht man deutlich die sechs bis acht Kammern des getrockneten weiblichen Fruchtstandes, in denen sich die Samen befinden – ein ästhetisch äußerst angenehmer Anblick, wie die hochglänzenden Samen hier nur ausschnitthaft zu sehen sind:

Öffnet man einen Samen, dann sieht das wie folgt aus. Man erhält zwei harte, glänzende Schalen und das eigentliche Innenleben des Samens – die Keimanlagen:

Ich habe einmal die einzelnen Bestandteile der Reihe nach probiert: das Sameninnere ist trocken und hat nur einen ganz leichten Anisgeschmack. Es dominiert eine bittere Note. Die Hüllen schmecken schon deutlich intensiver nach Sternanis. Besonders schön ist die chitinartig-knusprige Konsistenz. Die äußere Schale ist der stärkste Geschmacksträger, allerdings lässt sich dieser Teil nur schwer kauen. Deshalb wird üblicherweise die gesamte Frucht kleingemalen oder gemörsert.
Sternanis ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Küche. In Verbindung mit Zwiebeln und Sojasauce entstehen schwefelphenolische Aromaverbindungen, die sich dafür eignen, die Fleischnote hervorzuheben. Sternanis ist also ein natürlicher Umamiverstärker. Aber die hauptsächliche Verwendung ist mittlerweile nicht mehr das klassische chinesische Fünf-Gewürze-Pulver oder die keralische Garam-Masala-Variante, sondern liegt in der Medizin: der größte Teil der Ernte dieser Frucht geht in die Fabriken von Roche, wo aus der attraktiven Frucht das Antigrippemittel Tamiflu hergestellt wird. Aber bereits früher wurde die Frucht auch medizinisch eingesetzt: etwa als Gegenmittel zu Säuglingskoliken. Auch gegen Rheuma wurde die Pflanze in China eingesetzt.
Wer sich mit diesem Gewürz einmal auseinandersetzen möchte, dem sei dieses Heston Blumenthalsche Rezept für Spaghetti bolognese empfohlen, in dem Sternanis eine wichtige Rolle spielt (die Zubereitung dauert allerdings etwa neun Stunden):
Caramelising onions with star anise produces vibrant flavour compounds that really enhance the meaty notes of the sauce

 Die lebhafte Diskussion über die molekulare Küche (siehe
Die lebhafte Diskussion über die molekulare Küche (siehe 



 Die beiden israelischen Forscher
Die beiden israelischen Forscher 



 Weihnachtszeit ist Rezeptezeit. Und da gilt es zu beweisen, dass die molekulare Küche zu mehr taugt als zu sternedekorierten Degustationsmenüs in 25 Gängen. Die Frage lautet jetzt: Was leistet die molekulare Küche bei feiertagspraktischen Problemen mit Gans, Ente und Kartoffeln. So stellten die Leser des Independent am vergangenen Freitag Heston Blumenthal zur Rede und
Weihnachtszeit ist Rezeptezeit. Und da gilt es zu beweisen, dass die molekulare Küche zu mehr taugt als zu sternedekorierten Degustationsmenüs in 25 Gängen. Die Frage lautet jetzt: Was leistet die molekulare Küche bei feiertagspraktischen Problemen mit Gans, Ente und Kartoffeln. So stellten die Leser des Independent am vergangenen Freitag Heston Blumenthal zur Rede und  Schokolade und Blauschimmelkäse? Nicht unbedingt die Paarung, an die man auf Anhieb denkt, wenn es gilt eine leckere Nachspeise zu backen. Aber die aromentheoretische Verbindung, die Foodpairing anzeigt, lässt sich mit Heston Blumenthals (bzw.
Schokolade und Blauschimmelkäse? Nicht unbedingt die Paarung, an die man auf Anhieb denkt, wenn es gilt eine leckere Nachspeise zu backen. Aber die aromentheoretische Verbindung, die Foodpairing anzeigt, lässt sich mit Heston Blumenthals (bzw.