
Um festzustellen, dass Essen etwas mit Gewalt zu tun hat, muss man nicht das Extremfall des Kannibalismus bemühen. Mit jedem Bissen verleibt man sich etwas anderes, unterlegenes ein. Auf den ersten Blick recht unproblematisch stellt sich das im Alten Testament dar: „Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht“ (1. Mos 1, 28). Der Mensch wird als Krone der Schöpfung gesetzt und hat insofern (später dann allerdings im Schweiße seines Angesichts) das angestammte Geburtsrecht, Teile der Schöpfung zu verspeisen.
In vielen anderen Kulturen – den meisten? Ethnologen können stundenlang Rituale und Mythen schildern, die sich um das Verspeisen drehen – ist dieses konsummierende Verhältnis zur pflanzlichen und tierischen Umwelt ein tiefes Problem, da dort kein prinzipieller Unterschied zwischen Mensch und Natur gemacht wird. Für uns triviale Akte wie das Verspeisen einer Yamswurzel wird zum Beispiel für die Abelam in Papua-Neuginea zu einem Brudermord, der nur mit Hilfe eines ausgeklügelten mythologischen Apparats wieder ins Gleichgewicht eingefügt werden kann. Ganz zu schweigen von dem eigentlich unmöglichen, aber dennoch notwendigen Verspeisen des eigenen Totemtiers, durch das die animalische Kraft auf den Menschen und seine Gemeinschaft übertragen werden kann – die unio mystica kann auf diese Weise erneuert und vertieft werden.
Man sieht sehr schnell, dass es im Wesentlichen darum geht, dem Essen (und Töten, Ernten) einen Sinn zu geben, der diese Störung der kosmischen Ordnung neutralisieren kann. Essen ist von Anfang an eine sinnhafte Tätigkeit und nicht nur die Aufnahme von Kalorien.
 Möchte man diesen Zusammenhang von Essen und Gewalt auch einmal praktisch erfahrbar machen, bietet die haute cuisine zahlreiche Beispiele, die sich dazu eignen, sich dieser Problematik selbst einmal konsummatorisch zu nähern. Zum Beispiel das folgende Kalbsragout „Marengo“. Es ist benannt nach dem kleinen Ort in der Mitte des Dreiecks Mailand, Genua, Turin, in dem Bonaparte (später Napoléon I) im Jahr 1800 die von Michael Friedrich Benedikt von Melas angeführten österreichischen Truppen geschlagen hat, die sich daraufhin der Konvention von Alessandria unterworfen haben und Italien verließen.
Möchte man diesen Zusammenhang von Essen und Gewalt auch einmal praktisch erfahrbar machen, bietet die haute cuisine zahlreiche Beispiele, die sich dazu eignen, sich dieser Problematik selbst einmal konsummatorisch zu nähern. Zum Beispiel das folgende Kalbsragout „Marengo“. Es ist benannt nach dem kleinen Ort in der Mitte des Dreiecks Mailand, Genua, Turin, in dem Bonaparte (später Napoléon I) im Jahr 1800 die von Michael Friedrich Benedikt von Melas angeführten österreichischen Truppen geschlagen hat, die sich daraufhin der Konvention von Alessandria unterworfen haben und Italien verließen.
Da Bonaparte wie üblich nüchtern ins Gefecht ging war er von der wilden Verfolgung der österreichischen Truppen hungrig geworden. Er verlangte von seinem Koch Dunand eine sofortige Mahlzeit. Die Truppen schwärmten aus und fanden nur ein mageres Hühnchen, vier Tomaten, drei Eier, ein paar Flusskrebse, etwas Knoblauch, etwas Olivenöl und eine Bratpfanne. Aus diesen Zutaten bereitete der Koch – mit einem Schuss Cognac aus Bonapartes Trinkflasche und etwas trockenem Brot – sein Huhn „Marengo“ zu. Dieses Gericht schmeckte dem Feldherrn nicht nur besonders gut, sondern wurde für ihn das Symbol seines Sieges über die Österreicher, das er sich von nun an nach jedem Gefecht servieren ließ. Jegliche Modifikationen der Zutaten wurden strengstens untersagt und auch heute soll es noch Restaurants im Piedmont geben, die aus historischen (nicht: geschmacklichen!) Gründen diese ungewöhnliche Kombination aus Huhn und Flusskrebsen servieren.
Sehr schön auch die symbolische Parallelisierung von Mensch und Tomate in Raymond Olivers (ehemals Chefkoch im Grand Véfour) Deutungsvorschlag: „Pour remporter la victoire à Marengo, Bonaparte dut sacrifier in extremis son ami Desaix. Pour réussir cette recette, il faut au tout dernier moment sacrifier aussi la tomate.“
Bei Paul Bocuse taucht das Rezept als „Sauté de veau Marengo“ (Kalbsragout „Marengo“) auf, deutlich reduziert (Weißwein statt Cognac, keine Flusskrebse, keine Eier) und mit einer gefunden Pfanne nicht zu bewältigen, aber dennoch mit genügend Hinweisen auf die Entstehung des Gerichts wie zum Beispiel die Toastbrotherzen als Garnitur oder die große Menge Knoblauch und Zwiebelchen. Und natürlich auch die Tomaten.
Zutaten (6 Personen)
- 800g Kalbsfleisch, gewürfelt (ich habe Rindfleisch verwendet, wird zwar etwas bissfester, passt aber geschmacklich klasse)
- 100g Butter
- 2 EL Olivenöl
- 1 Möhre, in Scheiben geschnitten
- 2 mittlere Zwiebeln, geviertelt
- 20g Mehl
- 2 Knoblauchzehen
- 1/10l trockener Weißwein
- 200ml Tomatenmark
- 1 Kräutersträußchen (Petersilie, Thymian, Lorbeerblatt)
- 500g Kalbsfond
- 12 kleine Zwiebelchen
- 125g Champignons
- etwas Zitronensaft
- 6 in Butter geröstete Toastbrotherzen
- 1 TL gehackte Petersilie

Zubereitung
- In einem großen Topf 50g Butter und Olivenöl erhitzen. Dann die Fleischstücke (Bocuse sagt: vorher salzen, wir lassen das weg), die Möhre und die Zwiebeln hineingeben. Unter häufigem Wenden das Fleisch anbraten und so für die aromatischen Maillardprodukte sorgen. Nun das Mehl darüberstäuben – hier merkt man deutlich die ambivalente Position von Bocuse in der Geschichte der Nouvelle Cuisine, die sich gerade gegen die Mehlküche gerichtet hat – und goldbraun werden lassen. Jetzt noch die zerdrückten Knoblauchzehen dazu und kurze Zeit erhitzen, dann mit dem Weißwein ablöschen. Um 2/3 reduzieren und schließlich das Tomatenmark und soviel Fond dazugeben bis das Fleisch gerade bedeckt ist (bei Bedarf später noch etwas nachgießen). Unter Rühren aufkochen und dann bei milder Hitze 1 Stunde köcheln lassen.
- Zwiebelchen schälen, kurz überbrühen, trocknen und dann in 25g Butter anbraten bis sie goldbraun sind.
- Champignons putzen, waschen, abtropfen lassen. Stiele abschneiden und zum Ragout tun. Die Champignons schälen und die großen Pilze vierteln. In 25g Butter anbraten bis sie beginnen, etwas Farbe anzunehmen.
- Wenn das Ragout fertig gekocht ist, das Fleisch aus der Sauce nehmen und auf die warmen Champignons legen. Darüber die Zwiebeln streuen. Warm halten.
- Wenn nötig das Fett auf der Sauce abschöpfen, dann die Sauce durch ein Sieb über das Fleisch gießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann weitere 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen.
- Anrichten: Mit etwas Zitronensaft würzen, Petersilie darüber streuen und die Toastherzen dazulegen.



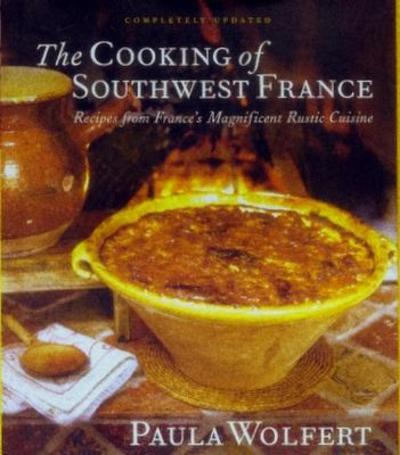


 Möchte man diesen Zusammenhang von Essen und Gewalt auch einmal praktisch erfahrbar machen, bietet die haute cuisine zahlreiche Beispiele, die sich dazu eignen, sich dieser Problematik selbst einmal konsummatorisch zu nähern. Zum Beispiel das folgende Kalbsragout „Marengo“. Es ist benannt nach dem kleinen Ort
Möchte man diesen Zusammenhang von Essen und Gewalt auch einmal praktisch erfahrbar machen, bietet die haute cuisine zahlreiche Beispiele, die sich dazu eignen, sich dieser Problematik selbst einmal konsummatorisch zu nähern. Zum Beispiel das folgende Kalbsragout „Marengo“. Es ist benannt nach dem kleinen Ort 

 Unter der krampfhaft witzigen Überschrift „Wir sind nicht ganz normal im Topf“
Unter der krampfhaft witzigen Überschrift „Wir sind nicht ganz normal im Topf“  Mittlerweile hat sich das Baskenland in ein Eldorado der molekularen Küche verwandelt, stellt die New York Times fest. Als besonders empfehlenswert wird Andoni Luis Aduriz‘ Restaurant „
Mittlerweile hat sich das Baskenland in ein Eldorado der molekularen Küche verwandelt, stellt die New York Times fest. Als besonders empfehlenswert wird Andoni Luis Aduriz‘ Restaurant „