
 Gestern habe ich mir endlich Marcella’s Italian Kitchen von Marcella Hazan zugelegt. Und schon im ersten Abschnitt über „Cooking: A Language“ stehen einige Dinge, die auch für unsere Theorie der kulinarischen Semantik wichtig sind. Kochen erscheint dort nicht als einfaches handwerklichen Können, sondern primär als Mittel zur Vergemeinschaftung:
Gestern habe ich mir endlich Marcella’s Italian Kitchen von Marcella Hazan zugelegt. Und schon im ersten Abschnitt über „Cooking: A Language“ stehen einige Dinge, die auch für unsere Theorie der kulinarischen Semantik wichtig sind. Kochen erscheint dort nicht als einfaches handwerklichen Können, sondern primär als Mittel zur Vergemeinschaftung:
[I]t is no coincidence that the campfires where human words were first exchanged also witnessed, at some point, the change from merely eating food that was gathered or caught to preparing it. Language has been described as a loom on which the fabric of society has been tightly woven. To a narrower, but nonetheless significant extent, the same can be said of cooking.
In unserer Kritik an dem kulinarischen Naturbegriff bekommen wir hier also Schützenhilfe von der zentralen Figur der klassischen italienischen Küche. Denn genau in dem Moment, in dem der Mensch Nahrung nicht nur en passant verzehrt, sondern sich der Zubereitung widmet, wird die Nahrungsaufnahme kultiviert. Hier liegt der Bruch mit der natürlichen Lebensweise. Wobei ich die These wagen würde, dass auch vor dieser steinzeitlichen Urkulinarik bereits kulinarische Zeichen existiert haben, zum Beispiel in der Verbindung bestimmter Farben mit Essbarkeit oder Giftigkeit. Aber das eher auf der Ebene z.B. der Kommunikation von Bienen, also noch nicht als Sprache.
Besonders gut gefällt mir die enge Verbindung des Kochens mit der Entstehung und Reproduktion von Gemeinschaft durch einen geteilten Geschmack – ganz analog zur gemeinsamen Sprache:
The evocations of flavor of shared cooking, like the familiar accents of a common tongue, established one’s identity, formed tribal bonds, chased solitude.
Ganz abgesehen davon, dass jeder wohl schon einmal selbst erfahren hat, wie ein gutes Essen mit Freunden oder Familie jeglichen Anflug von Einsamkeitsgefühlen in Luft aufgelöst hat, schafft das Kochen eine Gemeinschaft. Interessant dass Ferdinand Tönnies, der große soziologische Theoretiker von Gemeinschaft, zwar von Freundschaft, Verwandtschaft oder Nachbarschaft spricht, aber eine Vergemeinschaftung durch den Geschmack nicht erwähnt. Und mit Geschmack ist nicht der „gute Geschmack“ im Sinne von Veblen oder Bourdieu gemeint, sondern die basale Kategorie einer geteilten Geschmackswelt. Diese findet man paradigmatisch in Regionalküchen und -gerichten, die für Fremden höchst ungewöhnlich schmecken, da sie mit ihren kulinarischen Selbstverständlichkeiten brechen (daher auch Diskriminierungen wie „Spätzlefresser“, „Makkaroni“ oder „Knödelbayer“). Wahrscheinlich liegt genau in dieser heute in Resten noch vorhandenen kulinarischen Vergemeinschaftung der Reiz der exotischen Küchen. Im geteilten Geschmack oder Hazans „languages of cooking“ drückt sich also ein Wesenwillen aus, zu einem Kollektiv zu gehören. Die Vergemeinschaftung durch Konsum – man spricht hier von Markengemeinschaften oder sogar neotribalen Konsumgemeinschaften – ist in den letzten Jahren immer intensiver erforscht worden – wo bleibt die Forschung über Geschmacksgemeinschaften?
Wenn man das Kochen von dieser Seite her betrachtet, ergeben plötzlich auch einige Besonderheiten der Molekularen Küche Sinn. Denn hier hat man es verstärkt mit Zutaten zu tun, die keiner regionalen Koch- oder Essenstradition zuzuordnen sind. Es geht also, wenn man die Analogie von Kochen als Sprache hier fortführt, nicht um Lehnwörter, sondern um Kunstwörter. Ein Lehnwort wäre zum Beispiel die Verwendung des Lorbeerblattes in der deutschen Küche. Durch Apicius weiß man, dass dieses Gewürz in der Küche des alten Rom eine wichtige Beigabe für Gerichte aller Art gewesen ist (dort fand im Übrigen auch die Rinde Anwendung beim Kuchenbacken, siehe Catos De agricultura). Das Lorbeerblatt in deutschen Suppentöpfen ist also ein Lehnwort aus der römischen Küche (ein Latinismus), ganz ähnlich wie Fenster vom lateinischen fenestra stammt.
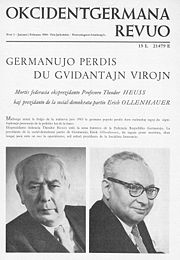 Dagegen lässt sich die Verwendung von Xanthan und Gellan, das Kryokochen oder das Aufschäumen keiner älteren Küche zuordnen, hier haben wir es demnach mit einem kulinarischen Esperanto zu tun. Genau wie das Esperanto nicht auf das Abschaffen der bestehenden Nationalsprachen abzielt, will die Molekulare Küche nicht die verschiedenen Regional- und Nationalküchen abschaffen, sondern im Gegenteil: es bedient sich der dort vorhandenen Vokabeln, grammatikalischen und phonetischen Regeln um sie zu einer neuen Sprache zu verbinden – zu esperantisieren. Zum Beispiel: Die Endung „-o“ kennzeichnet ein Substantiv. Von „Knabe“ kommt man dann schnell zum Esperantobegriff „knabo“. In der Molekularen Küche scheint es ähnliche (leider immer noch implizite) Grundregeln zu geben, wie man von einem klassischen Gericht zur molekularen Variante kommt: von der Foie gras zum knotbaren Foie-gras-Gel.
Dagegen lässt sich die Verwendung von Xanthan und Gellan, das Kryokochen oder das Aufschäumen keiner älteren Küche zuordnen, hier haben wir es demnach mit einem kulinarischen Esperanto zu tun. Genau wie das Esperanto nicht auf das Abschaffen der bestehenden Nationalsprachen abzielt, will die Molekulare Küche nicht die verschiedenen Regional- und Nationalküchen abschaffen, sondern im Gegenteil: es bedient sich der dort vorhandenen Vokabeln, grammatikalischen und phonetischen Regeln um sie zu einer neuen Sprache zu verbinden – zu esperantisieren. Zum Beispiel: Die Endung „-o“ kennzeichnet ein Substantiv. Von „Knabe“ kommt man dann schnell zum Esperantobegriff „knabo“. In der Molekularen Küche scheint es ähnliche (leider immer noch implizite) Grundregeln zu geben, wie man von einem klassischen Gericht zur molekularen Variante kommt: von der Foie gras zum knotbaren Foie-gras-Gel.
Doch Ziel des Ganzen ist nach wie vor – hier bin ich wieder bei Marcella Hazan – ein hervorragender Geschmack, bzw. etwas breiter: ein hervorragendes kulinarisches Erlebnis. Die Bedeutung des Kontextes, die etwa in der Küche Heston Blumenthals (The Fat Duck) eine zentrale Bedeutung hat, spielt Marcella immer wieder runter. Für sie sind das „incidentals“, die „may add circumstantial interest to the business of eating, but they add nothing to taste and signify nothing when taste is lacking“. Da ist die Geschmacksforschung mittlerweile anderer Ansicht und hat immer wieder belegt, welche Bedeutung z.B. das Aussehen eines Gerichtes sowie das, was wir darüber denken, für die empirische Geschmackswahrnehmung besitzt. Wenn es um diesen Aspekt geht, kann das Esperanto der Molekularen Küche tatsächlich eine wichtige Bereicherung der Geschichte des Essens darstellen.
(Abbildung oben: „ordering food without spoken language“ von Padday)

 Unter der krampfhaft witzigen Überschrift „Wir sind nicht ganz normal im Topf“
Unter der krampfhaft witzigen Überschrift „Wir sind nicht ganz normal im Topf“